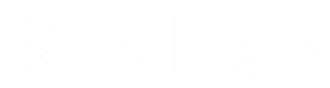Dr. Ohnemoos hat geschrieben:Wie sollen die Kinder arbeitender Eltern, die sehen, dass ihre Eltern sich von morgens bis abends den Arsch aufreißen, Respekt vor Kindern bekommen, deren Eltern nichts tun müssen und noch Klassenfahrten etc. pp. bezahlt bekommen ?
Vielleicht bringen die Kinder - gerade aufgrund ihrer Herkunft aus einem bildungsnäheren Milieu - ja noch genug Nachdenken auf, um zu realisieren, dass es nicht in der Verantwortung der Unterschichtskinder und oftmals auch deren Eltern liegt, dass diese in eine solche Lebenslage geraten sind. Du sagst doch selbst, dass wir so viele Leute gar nicht in Lohn und Brot halten können. Kinder sollten lernen, dass jeder Mensch Respekt verdient hat, unabhängig von seiner sozialen Herkunft. Das ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass man ihn von Kritik verschont, im Gegenteil.
Dr. Ohnemoos hat geschrieben:Es liegt jedoch auch in der Macht der Wohlfahrtsempfänger selbst, sich Respekt zu verschaffen, denn dieser fällt einem nicht einfach zu. Kein Wohlfahrtsempfänger wird ja daran gehindert, ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen, sich nützlich zu machen usw. Vor denen kann man dann auch Respekt haben. Vor anderen nicht. Respekt muss verdient werden.
Hier müssen wir im Grunde ein großes philosophisches und psychologisches Fass aufmachen. Denn deine Position unterstellt den "Wohlfahrtsempfängern" implizit Willensfreiheit, zumindest aber ein breites Wissen um alternative Handlungsmöglichkeiten. Nicht allen, aber vielen Hartz-IV-Empfängern fehlt es aber entweder an dem rigorosen bürgerlichen Leistungsethos, das du hier im Grunde voraussetzt, oder es wurde ihnen im Laufe ihres Lebens schmerzlich klargemacht, dass ihre Leistung überhaupt nicht erwünscht ist. Wie viele Betriebe wurden plattgemacht, weil sie nicht genug Rendite erwirtschafteten, wie viele Leute wurden durch Maschinen ersetzt, obwohl sie engagiert arbeiteten? Wer solche Erfahrungen gemacht hat, hat ein sehr großes Risiko in Apathie zu verfallen, gar depressiv zu werden. Anstatt der wissenschaftlich gut belegten Faktenlage ins Gesicht zu sehen und anzuerkennen, dass solche Reaktionen normale Abläufe der Hirnphysiologie sind, wird den Arbeitslosen aber auch noch im besten religiösen Konzept von Willensfreiheit und Schuld ein Vorwurf gemacht.
Das heißt gar nicht einmal, dass ich dir im Grundsatz in einigen Punkten nicht zustimmen würde. Respekt, der über den Grundrespekt vor jedem Menschen hinausgeht, muss durch Leistung - am besten für das Gemeinwesen - verdient werden. Allerdings stellt sich doch die Frage, warum jemand sich um solchen Respekt bemühen sollte, wenn er permanent solchen Schuldvorwürfen ausgesetzt ist. Die wenigsten Arbeitslosen sind solche Schmarotzer, wie es öffentlichkeitswirksam gerne dargestellt wird. Viele würden sich gerne einbringen und auch gerne arbeiten, erleben aber nicht, dass das außerhalb von Sonntagsreden ernsthaft gewollt ist. Wie wäre es denn, wenn wir beispielsweise denen einen moderaten Zuschlag auf ihr Arbeitslosengeld gewähren, die sich ehrenamtlich engagieren? Es geht dabei mehr um eine symbolische Anerkennung der Gesellschaft, um die Botschaft, dass wir auch eine solche Leistung würdigen und als produktiv für die Gesellschaft ansehen. Solange die Gesellschaft nicht auch signalisiert, dass sie bereit ist, mit sich engagierenden Arbeitslosen "Frieden zu schließen" anstatt sie dauernd als sozialen Müll zu behandeln, wird sich die breite Masse kaum für einen solchen Weg entscheiden. Das fördert man beispielsweise durch solche entsolidarisierenden Aussagen genau nicht:
Dr. Ohnemoos hat geschrieben:Ich bin auch für weniger Diffamierung. Für weniger Diffamierung derjenigen, die den Wohlstand produzieren. 17,5 % der Bevölkerung zahlen 66 % der Steuern (Gerd Habermann). Ich kann nur eins erkennen: Diffamierung und Verfolgung von Leistungswilligkeit.
Zu diesen Zahlen muss man nämlich auch noch ganz andere Sachen sagen, beispielsweise, dass 10% der Bevölkerung 60% des deutschen Vermögens besitzen und dass diese Entwicklung eine steigende Tendenz besitzt. Die sogenannten Leistungswilligen, vielleicht auch einfach die, die das Glück hatten, in ein anderes Milieu hineingeboren worden zu sein und anders geprägt wurden, eignen sich also immer mehr an, während die bösen Leistungsverweigerer, anders gesagt einfach die, die nicht die soziale Macht und soziale, vielleicht auch genetische, Voraussetzung besitzen, sich nach oben durchzukämpfen, sich immer mehr verschulden. Es sind folglich am anderen Ende 70% der Bevölkerung, die nur 9% des Vermögens besitzen. Fraglich, ob die wirklich alle leistungsunwillig sind oder ob wir es hier nicht einfach mit einem gesellschaftspolitischen Problemkomplex zu tun haben, der über monokausale, schon an der Grenze zum Populismus vegetierenden, Ansätze wie "Diffamierung und Verfolgung von Leistung " kaum zu erklären ist.
Wer sagt denn eigentlich, dass den Leistungswilligen alles zusteht, was der Markt theoretisch für sie hergibt? Wert und Preis einer Sache sind selten dasselbe. Ich gönne jedem Leistungsträger das mehrfache Einkommen eines einfachen Bürgers, meinetwegen das 30- oder 40fache, aber irgendwo ist die Grenze erreicht, wo Kapitalakkumulation in den Händen einer einzigen Person schlichtweg unsozial und auch unnötig wird. Unsere Gesellschaft baut seit jeher auf Kooperation genauso wie auf Selektion, beides idealerweise aber in einem vernünftigen Verhältnis zueinander. An welchem Punkt nochmal ist uns die Wertschätzung der Bescheidenheit abhanden gekommen? Reicht es denn nicht, wenn man schon wesentlich mehr hat, als ein Durchschnittsbürger, zumal ja noch die nicht minder harte Währung des gesellschaftlichen Ansehens dazukommt? Zumal die Wissenschaft, soweit ich das sehe, solche Schlüsse ja durchaus nahelegt, dazu drei Beispiele:
Es gibt viele vernünftige Stimmen, beispielsweise Michael Schmidt-Salomon mit seinem neuen Buch, in dem er sehr verständlich klarstellt, dass Charakterzüge Folge einer genetischen und sozialen Determinierung sind und es daher reichlich unmenschlich ist, denjenigen, die einfach das Pech hatten, als "Versager" geboren zu werden, einen Schuldvorwurf daraus zu machen.
Oder Richard Wilkinson: Der englische Ökonom und Epidemologe wies vor kurzem in einer breiten statistischen Untersuchung nach, dass soziale Ungleichheit zu sozialen und psychischen Verwerfungen und Problemen führt, die sowohl die Armen
als auch die Reichen unglücklicher machen, als in Staaten mit nivellierteren Vermögensverteilungen. Vermutlich liegt die Erklärung in geringerem Vertrauen der Menschen ineinander und permanenten Versagens- und Abstiegsängsten. So ist die Zahl der schweren psychischen Erkrankungen in den USA fünfmal höher als in Skandinavien - und zwar in
allen Gesellschaftsschichten.
Sehr lesenswert in dem Zusammenhang auch ein Text von Burkhard Müller:
Das Geld langt für alle - Aber die Arbeit nicht: Zum Sozialstaat gibt es keine Alternative