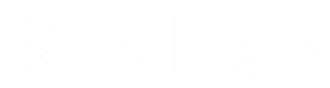darwin upheaval hat geschrieben:Jeder, der einen Gedanken denkt und diesem zustimmt, hält ihn aus seiner eigenen, subjektiven Sicht für wahr.
Ja.
darwin upheaval hat geschrieben:Folglich weiß er etwas, oder aus dem Blickwinkel anderer: er meint, etwas zu wissen. Z. B. weiß ein Reinhard Junker, dass Gott existiert. Damit ist noch lange nicht gesagt, dass dieses Stück Wissen intersubjektiv gültig und objektiv wahr ist.
"12. – Denn 'Ich weiß…' scheint einen Tatbestand zu beschreiben, der das Gewusste als Tatsache verbürgt. Man vergisst eben immer den Ausdruck 'Ich glaubte, ich wüsste es'.
13. Es ist nämlich nicht so, dass man aus der Äußerung des Andern 'Ich weiß, dass es so ist' den Satz 'Es ist so' schließen könnte. Auch nicht aus der Äußerung und daraus, dass sie keine Lüge ist. – Aber kann ich nicht aus meiner Äußerung 'Ich weiß etc.' schließen 'Es ist so'? Doch, und aus dem Satz 'Er weiß, dass dort eine Hand ist' folgt auch 'Dort ist eine Hand'. Aber aus seiner Äußerung 'Ich weiß…' folgt nicht, er wisse es.
14. Es muss erst erwiesen werden, dass er's weiß.
15. Dass kein Irrtum möglich war, muss erwiesen werden. Die Versicherung 'Ich weiß es' genügt nicht. Denn sie ist doch nur die Versicherung, dass ich mich (da) nicht irren kann, und dass ich mich darin nicht irre, muss objektiv feststellbar sein."(L. Wittgenstein,
Über Gewissheit)
Daraus, dass Junker glaubt zu wissen, dass Gott existiert, folgt nicht, dass er tatsächlich weiß, dass Gott existiert. Aus seiner Behauptung, er wisse es, folgt eben nicht, dass er es weiß.
Wenn Gott nicht existiert, dann besitzt er kein falsches Wissen, sondern einen falschen
Wissensglauben.
darwin upheaval hat geschrieben:
Glaube unterscheidet sich von Wissen m.E. nur in Bezug auf die Objektivität.
Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass es sowohl wahres als auch falsches Glauben gibt, aber kein falsches Wissen.
darwin upheaval hat geschrieben:
Glaube ist immer subjektiv, Wissen dagegen in der Regel intersubjektiv nachvollziehbar bzw. rational rekonstruierbar.
Auch Mahner & Bunge unterscheiden zwischen privatem und nichtprivatem Wissen:
"Eine verwandte Einteilung ist die in privates und öffentliches Wissen. Wir sagen, jemand besitzt privates Wissen über x gdw niemand sonst x weiß. Andernfalls, d.h. wenn ein Stück Wissen wenigstens von einigen Mitgliedern einer Sozietät geteilt wird, ist es öffentliches oder intersubjektives Wissen. Privates Wissen kann weiter unterteilt werden in Wissen über jemandes eigene Zustände (oder Prozesse), insbesondere Gehirnprozesse (z.B. wie ich mich gerade fühle), und Wissen, das lediglich geheimgehalten wird."(Mahner, Martin, und Mario Bunge.
Philosophische Grundlagen der Biologie. Berlin: Springer, 2000. S. 64)
darwin upheaval hat geschrieben: Myron hat geschrieben:[D]er Begriff "falsches Wissen" ist so selbstwidersprüchlich wie "falsche Tatsache".
Der ist überhaupt nicht selbstwidersprüchlich, sondern die logische Folge unseres unzureichenden Erkenntnisapparats.
"Tatsachen" sind nicht selbstevident, sondern werden theoretisch (re-) konstruiert.
Es gibt zwei Auffassungen von Tatsachen: Für die einen ist eine Tatsache einfach eine wahre Aussage (oder ein wahrer Gedanke [Frege]) und für die anderen ein (sprachunabhängig) bestehender, wirklicher Sachverhalt. Nach der ersten Definition kann es keine falschen Tatsachen gegen, da es keine falschen wahren Aussagen geben kann; und nach der zweiten Definition kann es keine falschen Tatsachen geben, da man einen Kategorienfehler begeht, wenn man einem Sachverhalt die Eigenschaft des Wahr- bzw. Falschseins zuspricht.
Und was die angebliche "Konstruktion" von Tatsachen betrifft, so setzen wir zwar innerhalb der soziokulturellen Sphäre durch unser Denken und Handeln neue Tatsachen (vor allem institutionelle) in die Welt, aber all die natürlichen Tatsachen, um deren Aufdeckung sich die Naturwissenschaften bemühen, sind nicht "theoretisch konstruiert"; denn sie bestehen theorie-, sprach- und geistunabhängig.
darwin upheaval hat geschrieben:
Da Theorien fehlbar sind, kann es auch falsche Tatsachen geben. Z. B. war es bis ins 20. Jahrhundert eine gewusste Tatsache, dass Raum und Zeit invariante (bezugspunktunabhängige) Größen sind. Bis Einstein kam und zeigte, dass das streng genommen nicht der Fall ist.
Wenn Einstein recht hat und Newton unrecht, dann war der Sachverhalt, dass Raum und Zeit voneinander unabhängige Größen sind,
niemals eine Tatsache und die entsprechende Aussage
niemals wahr.
Wie gesagt, wenn Einstein recht hat, dann haben die Anhänger der Newton'schen Physik niemals gewusst, dass diese wahr ist, sondern nur irrtümlicherweise
geglaubt zu wissen, dass sie wahr ist.
darwin upheaval hat geschrieben:
Das Wissen um die Newtonsche Physik erwies sich zwar nicht als rundweg falsch, aber nur als als partiell richtig.
Hierzu noch einmal folgender Kommentar:
"Although the truth-condition enjoys nearly universal consent, let us nevertheless consider at least one objection to it. According to this objection, Newtonian Physics is part of our overall scientific knowledge. But Newtonian Physics is false. So it's possible to know something false after all.
In response, let us say that Newtonian physics involves a set of laws of nature {L1, L2,…, Ln}. When we say we know Newtonian physics, this could be interpreted as saying we know that, according to Newtonian physics, L1, L2,…, Ln are all true. And that claim is of course true.
Additionally, we can distinguish between two theories, T and T*, where T is Newtonian physics and T* updated theoretical physics at the cutting edge. T* does not literally include T as a part, but absorbs T by virtue of explaining in which way T is useful for understanding the world, what assumptions T is based on, where T fails, and how T must be corrected to describe the world accurately. So we could say that, since we know T*, we know Newtonian physics in the sense that we know how Newtonian physics helps us understand the world and where and how Newtonian physics fails."(
http://plato.stanford.edu/entries/knowledge-analysis)
darwin upheaval hat geschrieben: Myron hat geschrieben:"(i) x glaubt y =df x weiß y und x stimmt y zu;…"
Es erscheint mir logisch "pervers", Wissen zu einer notwendigen Bedingung für Glauben zu machen.
"Pervers" erscheint es Dir nur deshalb, weil es Deiner "gefühlt richtigen" Definition von "Wissen" widerspricht. Aber diese Definition kannst Du eben nicht erzwingen. Es gibt Wissenschaftsphilosophen, die halten Deine Definiton für "pervers": Es muss die Existenz postulierter Dinge erst unfehlbar
bewiesen werden, bevor deren Existenz gewusst wird. Die Folge wäre, dass es überhaupt kein Wissen gäbe, und das Unternehmen
Wissenschaft von vorn herein überflüssig wäre, weil dann eben nur jeder seine Hirngespinste hätschelte, ohne das Wort "Wissen" in den Mund nehmen zu dürfen.
Man muss doch wahrlich kein akademisch ausgebildeter Philosoph oder Logiker sein, um die Widersinnigkeit von Sätzen der folgenden Form zu erkennen:
"Obwohl die Aussage A falsch ist, wissen einige Leute, dass A wahr ist.""'S knows that p only if p is true' gives a non-optional condition for knowledge: it is totally eccentric to say that though p is false still N knows that p."(Nathan, N. M. L.
The Price of Doubt. London: Routledge, 2001. p. 17)
Ja, das ist wirklich "total exzentrisch"!
"[Y]ou can only speak of 'knowledge' if the thing said to be known is in fact the case. If it is not the case, then it is a semantic rule of English that the cognitive attitude involved is not to be called 'knowledge'. The word has a demand for truth built into its meaning[.]" (Armstrong, D. M.
Belief, Truth and Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1973. p. 138)
Andererseits habe in einem vorherigen Beitrag unter Berufung auf David Lewis ja schon angedeutet, wie der Wissensbegriff gegen die Panskeptiker verteidigt werden könnte:
viewtopic.php?p=66694#p66694Außerdem denke ich, dass es eigentlich um zwei unterschiedliche Aspekte geht:
Zum einen um die Frage, ob man einen Wissensanspruch auf eine Aussage A auch dann erheben darf, wenn die Beweise für A nicht alle logischen Möglichkeiten ausschließen, in denen die Beweise gleich sind, aber A falsch ist; und zum anderen um die Frage, ob auch dann ein Fall von Wissen, dass A wahr ist, vorliegen kann, wenn A nicht wahr ist.
Es mag sein, dass
Wissensansprüche (und damit überhaupt die Verwendung des Wissensbegriffs) auch dann berechtigt und zulässig sind, wenn gewisse Irrtumsmöglichkeiten übrig bleiben; aber es kann nicht sein, dass
De-facto-Wissen vorliegt, wenn das Geglaubte falsch ist.
Wie Armstrong mit Recht unterstreicht:
"The word ['knowledge'] has a demand for truth built into its meaning[.]"Der Wissensanspruch in Bezug auf die Newton'sche Theorie mag im 18. Jahrhundert angesichts der damals gegebenen wissenschaftlichen Belege voll und ganz berechtigt gewesen sein; doch wenn stattdessen die Einstein'sche Theorie wahr ist, dann liegt dem Wissensanspruch der damaligen Physiker eben nur ein irrtümlicher Wissensglaube und kein De-facto-Wissen zugrunde.
Es kann einfach nicht sein, dass die Physiker im 21. Jahrhundert wissen, dass die Theorie T falsch ist, und die Physiker im 18. Jahrhundert wussten, dass dieselbe Theorie T wahr ist.
darwin upheaval hat geschrieben:
Der Sicherheitsanspruch, den Du an "Wissen" stellst, ist grundsätzlich nicht einlösbar. Damit wäre das Unternehmen namens "Wissenschaft" von vorn herein fehletikettiert, und Du müsstest sie als "Glaubensschaft" bezeichnen.
Ich fürchte, du hast mich großteils missverstanden. Ich behaupte ja gar nicht, dass wir niemals das Recht haben, Wissensansprüche zu erheben, oder dass wir niemals etwas wissen.
Ich habe hier hauptsächlich nur das von
so gut wie allen Erkenntnistheoretikern und Wissenslogikern anerkannte und verwendete Axiom
Kp –> p verteidigt, das eigentlich eine Binsenwahrheit ist.
Umso verwunderter bin ich darüber, dass du dieses so entschieden ablehnst.
(Ich hoffe, dass du es nach meinen Ausführungen nicht länger ablehnst.)