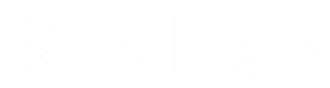Einschätzung von Wikileaks
80 Beiträge
• Seite 1 von 4 • 1, 2, 3, 4
Einschätzung von Wikileaks
Wie denkt ihr darüber, dass geheime Informationen einfach so veröffentlicht werden? Was denkt ihr ist von den Vorwürfen gegen Asange zu halten?
- Bionic
- Beiträge: 488
- Registriert: Sa 29. Mai 2010, 18:19
- Wohnort: Vorarlberg/ Österreich
Re: Einschätzung von Wikileaks
Bionic hat geschrieben:Wie denkt ihr darüber, dass geheime Informationen einfach so veröffentlicht werden?
Es gibt nichts neues unter der Sonne. Beim Kacken sehn von unten alle gleich aus. Bisher habe ich jedenfalls noch nichts vernommen, was mich irgendwie erstaunt hätte. Das Bewusstsein, gesehen zu werden, macht den Menschen außerdem nachweislich menschlicher

Bionic hat geschrieben:Was denkt ihr ist von den Vorwürfen gegen Asange zu halten?
Nicht einzuschätzen. Ein Mann der sich so viel Profis zu Feinden gemacht hat, hat auch welche darunter, die es verstehen, ihm etwas anzudrehen. Aber genau dieser Umstand kann ihn dazu verleitet haben, sich Narrenfreiheit zu nehmen, eben weil man daraus prima Verschwörungstheorien basteln kann.
-

ujmp - Beiträge: 3108
- Registriert: So 5. Apr 2009, 19:27
Re: Einschätzung von Wikileaks
ujmp hat geschrieben:Bisher habe ich jedenfalls noch nichts vernommen, was mich irgendwie erstaunt hätte. Das Bewusstsein, gesehen zu werden, macht den Menschen außerdem nachweislich menschlicher
Warum wird er dann so verurteilt dafür? Du bist also für mehr Videoüberwachung?
- Bionic
- Beiträge: 488
- Registriert: Sa 29. Mai 2010, 18:19
- Wohnort: Vorarlberg/ Österreich
Re: Einschätzung von Wikileaks
Wikileaks im Allgemeinen und Assange im Besonderen ist in meiner Wertschätzung in den letzten Tagen ziemlich krass gefallen.
Solange Wikileaks Zustände aufgedeckt hat, über deren Nichthinnehmbarkeit unter allen Befürwortern von Rechtstaatlichkeit Einigkeit herrscht, beispielsweise das Helikoptervideo aus dem Irak oder die Dokumente über Korruption in Kenia, stand ich voll hinter dem, was Wikileaks tat, nämlich dem klassischen Whistleblowing. Seitdem aber klarer geworden ist, dass es Assange um soetwas nur sekundär geht und sein Hauptanliegen die Durchsetzung seiner anarchistischen Weltsicht ist und dass er es nicht nur hinnimmt, sondern sogar gutheißt, dass seine Veröffentlichungen vermeidbaren Schaden anrichten ("ein oder zwei Banken könnten schon draufgehen"), habe ich kaum noch Sympathien für Wikileaks. Assange ist ein pauschaler Gegner des Staates, den er durch den Geheimnisverrat schwächen will, da habe ich natürlich mit meinen doch recht republikanischen Ansichten natürlich keine Anknüpfungspunkte. Mit der Arbeit, die Bob Woodward, Carl Bernstein oder Seymour Hersh getan haben, hat der Weg, den Wikileaks jüngst eingeschlagen hat, jedenfalls nichts mehr zu tun.
Die SZ meldete gestern oder vorgestern, dass Daniel Domscheit-Berg, der kürzlich im Streit von Wikileaks schied, mit Weggefährten den Aufbau einer Konkurrenzplattform zu Wikileaks betreibt. Wenn das der Fall sein sollte, dann hoffe ich, dass dieses Projekt sich wieder auf den konstruktiven Weg des verantwortungsvollen Whistleblowings begibt und nicht pauschal alles veröffentlicht, was es in die Finger kriegen kann und das Wikileaks entweder seinen Kurs ändert oder abgeschossen wird.
Was die Vorwürfe gegen Assange betrifft, so maße ich mir kein Urteil dazu an, was dahinter steckt. Sollte es zu einem Prozess kommen, dann hoffe ich, dass er fair und unabhängig sein wird und das Gericht den Mut besitzt, eine Entscheidung zu treffen, die dem Fall gerecht wird und sich nicht an der Washingtoner Blutlust orientiert.
Solange Wikileaks Zustände aufgedeckt hat, über deren Nichthinnehmbarkeit unter allen Befürwortern von Rechtstaatlichkeit Einigkeit herrscht, beispielsweise das Helikoptervideo aus dem Irak oder die Dokumente über Korruption in Kenia, stand ich voll hinter dem, was Wikileaks tat, nämlich dem klassischen Whistleblowing. Seitdem aber klarer geworden ist, dass es Assange um soetwas nur sekundär geht und sein Hauptanliegen die Durchsetzung seiner anarchistischen Weltsicht ist und dass er es nicht nur hinnimmt, sondern sogar gutheißt, dass seine Veröffentlichungen vermeidbaren Schaden anrichten ("ein oder zwei Banken könnten schon draufgehen"), habe ich kaum noch Sympathien für Wikileaks. Assange ist ein pauschaler Gegner des Staates, den er durch den Geheimnisverrat schwächen will, da habe ich natürlich mit meinen doch recht republikanischen Ansichten natürlich keine Anknüpfungspunkte. Mit der Arbeit, die Bob Woodward, Carl Bernstein oder Seymour Hersh getan haben, hat der Weg, den Wikileaks jüngst eingeschlagen hat, jedenfalls nichts mehr zu tun.
Die SZ meldete gestern oder vorgestern, dass Daniel Domscheit-Berg, der kürzlich im Streit von Wikileaks schied, mit Weggefährten den Aufbau einer Konkurrenzplattform zu Wikileaks betreibt. Wenn das der Fall sein sollte, dann hoffe ich, dass dieses Projekt sich wieder auf den konstruktiven Weg des verantwortungsvollen Whistleblowings begibt und nicht pauschal alles veröffentlicht, was es in die Finger kriegen kann und das Wikileaks entweder seinen Kurs ändert oder abgeschossen wird.
Was die Vorwürfe gegen Assange betrifft, so maße ich mir kein Urteil dazu an, was dahinter steckt. Sollte es zu einem Prozess kommen, dann hoffe ich, dass er fair und unabhängig sein wird und das Gericht den Mut besitzt, eine Entscheidung zu treffen, die dem Fall gerecht wird und sich nicht an der Washingtoner Blutlust orientiert.
-
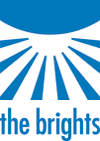
Nanna - Mitglied des Forenteams

- Beiträge: 3338
- Registriert: Mi 8. Jul 2009, 19:06
Re: Einschätzung von Wikileaks
Nanna hat geschrieben:da habe ich natürlich mit meinen doch recht republikanischen Ansichten natürlich keine Anknüpfungspunkte.
Su bist republikanisch?? Dann wirst du dich über Obama ja nicht gerade gefreut haben? Aber Republikaner wollen doch eigentlich weniger Staat?
- Bionic
- Beiträge: 488
- Registriert: Sa 29. Mai 2010, 18:19
- Wohnort: Vorarlberg/ Österreich
Re: Einschätzung von Wikileaks
Bionic hat geschrieben:ujmp hat geschrieben:Bisher habe ich jedenfalls noch nichts vernommen, was mich irgendwie erstaunt hätte. Das Bewusstsein, gesehen zu werden, macht den Menschen außerdem nachweislich menschlicher
Warum wird er dann so verurteilt dafür? Du bist also für mehr Videoüberwachung?
Nicht nötig, es gibt immer jemanden der es uns verrät. Wie man sieht, muss man ihnen nur eine Plattform bieten.
-

ujmp - Beiträge: 3108
- Registriert: So 5. Apr 2009, 19:27
Re: Einschätzung von Wikileaks
Bionic hat geschrieben:Nanna hat geschrieben:da habe ich natürlich mit meinen doch recht republikanischen Ansichten natürlich keine Anknüpfungspunkte.
Su bist republikanisch?? Dann wirst du dich über Obama ja nicht gerade gefreut haben? Aber Republikaner wollen doch eigentlich weniger Staat?
Meine politischen Ansichten haben wenig bis nichts mit dem gemein, was die Republican Party in den USA oder die Partei "Die Republikaner" in Deutschland vertreten. Ich fürchte, du musst bei deinem politischen Vokabular etwas nachbessern. Allerdings kann ich dir im Grunde keinen großen Vorwurf machen: Gerade die US-Amerikaner haben traditionell völlig verkorkste Begrifflichkeiten, so sind die Republicans entgegen der ideengeschichtlichen Tradition des Begriffs staatskritisch, sozialdemokratische Ansätze werden dagegen als "liberal" bezeichnet, in Europa und im Rest der Welt, wo man anscheinend nicht so große Schwierigkeiten hatte, ein paar simple Vokabeln zu behalten, bedeuten die beide Wörter genau das Gegenteil.
Kleiner Exkurs:
Ein republikanisches Staatsverständnis ist zuallererst einmal ein positives. "Positiv" wird hier im wertneutralen Zusammenhang verwendet: Im positiven Staatsverständnis hat der Bürger die Freiheit ZUM Staat, im negativen die Freiheit VOM Staat. Anders gesagt, im positiven, republikanischen Staatsverständnis steht das Recht des Bürgers (citoyen) auf Partizipation - oft auch die moralische Pflicht dazu - im Vordergrund, die klassische Staatsbürgertugend also. Das Gemeinwesen wird betont, weshalb beispielsweise das traditionell äußerst republikanisch gefärbte Frankreich immer sehr linke Tendenzen hatte.
Im negativen, liberalen Staatsverständnis, steht das Individuum und sein Recht vom Staat in Ruhe gelassen zu werden im Zentrum. Hier geht es stärker um individuelle Freiheiten, die gegen die Gemeinschaft geltend gemacht werden können. Der Staat gilt als Garant für die Wahrung der Gesetze und hat sich ansonsten aus dem Leben des Bürgers herauszuhalten.
Obama ist so gesehen eher auf der Seite der Republikaner zu sehen, sofern man das Wort im eigentlichen Wortsinne verwendet. Zu seiner Person will ich mich hier nicht äußern, meine Meinung dazu lässt sich nicht auf simple Zuneigung oder Ablehnung herunterbrechen. Assange dagegen hat mit keiner der beiden Seiten etwas zu tun, er besitzt ein völlig auf die Spitze getriebenes negatives Staatsverständnis, das nichteinmal mehr liberal oder libertär, sondern anarchistisch ist, darüberhinaus scheint er ziemlich totalitäre Denkweisen zu pflegen.
-
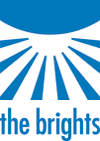
Nanna - Mitglied des Forenteams

- Beiträge: 3338
- Registriert: Mi 8. Jul 2009, 19:06
Re: Einschätzung von Wikileaks
Es ist natürlich erstmal interessant zu sehen wie gewisse Kommentatoren gleichzeitig den Neuigkeitswert bestreiten, als auch die Sprengkraft der Informationen betonen. Diese Behauptungen sind nur dann rational nachvollziehbar, wenn man die Verbreitung der Informationen unterbinden möchte (nur eben über zwei sich entgegengesetzte Strategien, die zusammen Blödsinn ergeben).
Wir haben jeden Tag Nachrichten. Da meldet sich kaum jemand und bestreitet den Nutzen oder Neuigkeitswert einer Meldung. Man kann beobachten wie sich manche Medien in Meta-Informationen (Nachrichten über die Nachrichten) in diesem Fall verstiegen. Da war WikiLeaks selbst wichtiger als die Informationen, die sie haben.
Sieh an. Verantwortung und Bild-Zeitung.
Ganz genau.
Mit anderen Worten: eine kleine Gruppe, die sich untereinander vertraut trifft die richtigen Entscheidungen für die Schäfchen, die sie beherrscht. Sehr treffend, auch wenn der Autor das wohl so nicht nicht meinte.
Es ist nicht die Aufgabe der Medien Behörden oder Unternehmen bei Cover-Ups zu helfen oder sich nur darum sorgen zu machen. Sonst interessierte es auch keinen ob Beispielsweise der Nachdruck von gewissen Karikaturen Sprengkraft entwickeln könnte, oder Enthüllungen aus dem Krieg bestimmte Leute in Gefahr bringen könnte. Das ist dann alles egal.
Und nichts interessantes?
Hier mal eine Auswahl des Guardian
Dazu wissen nun auch, was für Dünnbrettbohrer Westerwelle/Merkel sind, quasi als zusätzliche externe Meinung.
Wir haben jeden Tag Nachrichten. Da meldet sich kaum jemand und bestreitet den Nutzen oder Neuigkeitswert einer Meldung. Man kann beobachten wie sich manche Medien in Meta-Informationen (Nachrichten über die Nachrichten) in diesem Fall verstiegen. Da war WikiLeaks selbst wichtiger als die Informationen, die sie haben.
Handelsblatt hat geschrieben:Wo endet die Pressefreiheit? Wo beginnt ein destruktiver Prozess, der nicht nur Vertrauen quer über den Globus zerstört, sondern die Vertraulichkeit gleich mit? Im neuen Fall ist offenkundig, dass WikiLeaks übers Ziel hinausschießt.
Bild hat geschrieben:Aber zugleich setzt sich das Unternehmen über genau die Spielregeln hinweg, die seine Existenz erst ermöglichen. Das ist Anarchie. [...] ? Mit Freiheit und Wissen umzugehen bedeutet vor allem eines: Verantwortung. Aber dieser Begriff scheint den Online- Anarchos ein Fremdwort zu sein. Sie handeln schlicht kriminell!
Sieh an. Verantwortung und Bild-Zeitung.
Stern hat geschrieben:Das Märchen von "sauberen" Kriegen, transparenten Behörden, loyalen politischen Entscheidungen. Dass wir dieses Korrektiv dringend brauchen, haben die bisherigen Veröffentlichungen bewiesen. [...] Aufklärung, die eigentlich Sache investigativer Journalisten wäre. Nur die haben sich in den vergangenen Jahren nur selten mit Ruhm bekleckert.
Ganz genau.
FAZ hat geschrieben:Solche Enthüllungen können in den Krisenzonen der Welt weit destruktivere Wirkung entfalten als in den Spannungsgebieten der schwarz-gelben Koalition.
Süddeutsche Zeitung hat geschrieben:hne Information aber auch keine Kenntnis, keine Urteilskraft, keine richtigen Entscheidungen. [...] WikiLeaks hat sich nun als Massenvernichtungswaffe für das letzte Quäntchen Vertrauen erwiesen.
Mit anderen Worten: eine kleine Gruppe, die sich untereinander vertraut trifft die richtigen Entscheidungen für die Schäfchen, die sie beherrscht. Sehr treffend, auch wenn der Autor das wohl so nicht nicht meinte.
Es ist nicht die Aufgabe der Medien Behörden oder Unternehmen bei Cover-Ups zu helfen oder sich nur darum sorgen zu machen. Sonst interessierte es auch keinen ob Beispielsweise der Nachdruck von gewissen Karikaturen Sprengkraft entwickeln könnte, oder Enthüllungen aus dem Krieg bestimmte Leute in Gefahr bringen könnte. Das ist dann alles egal.
Und nichts interessantes?
Hier mal eine Auswahl des Guardian
- Silvio Berlusconi 'profited from secret deals' with Vladimir Putin
- The US pressured Spain over CIA rendition and Guantánamo
- US diplomats spied on the UN's leadership
- The scale of Afghan corruption is overwhelming
- Hillary Clinton queried Cristina Kirchner's mental health
- The Bank of England governor played backroom politics
- The British government remains in thrall to the US
Dazu wissen nun auch, was für Dünnbrettbohrer Westerwelle/Merkel sind, quasi als zusätzliche externe Meinung.
-

Lumen - Beiträge: 1133
- Registriert: Sa 30. Okt 2010, 01:53
Re: Einschätzung von Wikileaks
Na, ich weiß nicht, was an dem alles so überraschend sein soll. "Der Papst hat vier Kinder" oder "Obama hat 'Nigger' zu seiner Frau gesagt" - das hätte einen gewissen Überraschungswert gehabt. Oder "Westerwelle wird unterschätzt". Aber so...
-

ujmp - Beiträge: 3108
- Registriert: So 5. Apr 2009, 19:27
Re: Einschätzung von Wikileaks
Oder Silvio ist schwul und die Blondinen nur Tarnung, sowas wär der Hammer, aber doch nicht, daß er irgendwelche zwielichten Geschäfte macht, was anderes erwartet doch keiner von ihm.
musicman
musicman
- musicman
- Beiträge: 738
- Registriert: Mi 16. Sep 2009, 21:56
Re: Einschätzung von Wikileaks
Nanna hat geschrieben:Ich fürchte, du musst bei deinem politischen Vokabular etwas nachbessern.
Wäre meine zweite Überlegung gewesen. Allerdings kenne ich mich da nicht ganz so gut aus.
- Bionic
- Beiträge: 488
- Registriert: Sa 29. Mai 2010, 18:19
- Wohnort: Vorarlberg/ Österreich
Re: Einschätzung von Wikileaks
ujmp hat geschrieben:Na, ich weiß nicht, was an dem alles so überraschend sein soll. "Der Papst hat vier Kinder" oder "Obama hat 'Nigger' zu seiner Frau gesagt" - das hätte einen gewissen Überraschungswert gehabt. Oder "Westerwelle wird unterschätzt". Aber so...
musicman hat geschrieben:Oder Silvio ist schwul und die Blondinen nur Tarnung, sowas wär der Hammer, aber doch nicht, daß er irgendwelche zwielichten Geschäfte macht, was anderes erwartet doch keiner von ihm.
Versehe, also lieber mehr Nachrichten von Heidi Klum und Konsorten.
-

Lumen - Beiträge: 1133
- Registriert: Sa 30. Okt 2010, 01:53
Re: Einschätzung von Wikileaks
Dass Russland eine "Kleptokratie" ist, hab ich Boris Groys schon vor Jahren sinngemäß sagen hören. Selbstverständlich denkt sich ein westlicher Diplomat, der mit einem Russen spricht, seinen Teil. Es hätte mich eher beunruhigt, wenn die Amis den Russen dafür Anerkennung gezollt hätten, dass sich da ein paar Leute mit "Volkseigentum" zu Milliardären gemacht haben. Die Öffentlichkeit bewirkt doch nur, dass sich die Bonzen etwas mehr am Riemen reißen. Das ganze hat so eine Art der-Kaiser-ist-ja-nackt-Effekt. Ich find' das OK.
-

ujmp - Beiträge: 3108
- Registriert: So 5. Apr 2009, 19:27
Re: Einschätzung von Wikileaks
Lumen hat geschrieben:Und nichts interessantes?
Hier mal eine Auswahl des Guardian
- Silvio Berlusconi 'profited from secret deals' with Vladimir Putin
- The US pressured Spain over CIA rendition and Guantánamo
- US diplomats spied on the UN's leadership
- The scale of Afghan corruption is overwhelming
- Hillary Clinton queried Cristina Kirchner's mental health
- The Bank of England governor played backroom politics
- The British government remains in thrall to the US
Dass das uninteressant wäre, behauptet vermutlich keiner. Ich fand es für meinen Teil hochspannend, mal etwas aus der sonst hermetisch abgeschlossenen Welt der Diplomatie zu erfahren. Man sieht solche Szenen, in denen Verantwortliche Klartext reden, ja stonst nur in Spielfilmen. Ich verstehe auch die ganze Aufregung darum nicht. Dass Leute hinter verschlossenen Türen ihre Meinung über die Nachbarn ungeniert sagen, sollte jeder aus dem heimischen Schlafzimmer kennen.
Wenn Merkel und Westerwelle "Dünnbrettbohrer" sind, dann brauchen wir allerdings nicht - überspitzt gesagt - Geheimpapiere, die uns das bestätigen. Irgendwo geht da schon lange vorher die Verhältnismäßigkeit verloren. Wirklich neu war außerdem wirklich nichts, zumindest geahnt hat man vieles, was in den Depeschen stand. Wenn man bedenkt, was Verschwörungstheoretiker den Regierenden alles an Dreck und Perfidie andichten, dann muss man sich eigentlich wundern, dass das, was da veröffentlicht wurde, so banal und menschlich ist.
Das zentrale Problem ist meiner Meinung nach tatsächlich die Ideologie von Wikileaks, die im Geheimnisbruch an sich den Erfolg sieht. Wenn ein FDP-Bürochef Informationen aus innenpolitischen Verhandlungen an die US-Botschaft liefert, dann ist das zwar nicht die feine englische Art, aber Alltagsdreck, der im politischen Getriebe bedauerlicherweise anfällt. Ich für meinen Teil finde es da unverhältnismäßig, 300.000 geheime Dokumente zu veröffentlichen und damit den diplomatischen Betrieb zu kompromittieren, anstatt die dicken Köder herauszufischen und Belanglosigkeiten wie die Diskussionen über Berlusconis Schlafmangel der Boulevardpresse zu überlassen, die auf sowas auch von selbst kommen kann. Man muss Dinge nicht veröffentlichen nur aus dem Grund, dass man es kann.
Zumal die Frage ist, wem da eigentlich in die Hände gespielt wird: Sofern der investigative Journalismus auf seinem jetzigen Niveau verharrt und die konventionellen Medien nicht mit großem Aufwand diese Fluten an Dokumenten durchkämmen, bringen hunderttausende veröffentlichter Papiere überhaupt nichts. Wikileaks droht so an seinem eigenen Erfolg zu ersticken. Freude werden dagegen Geheimdienste und Konzerne haben, die die entsprechende Mannstärke aufweisen, um die tatsächlich brauchbaren Informationen abzugreifen. Es geht nunmal nicht ohne redaktionelle Überprüfung, dabei könnte dann auch das Belanglose aussortiert und unveröffentlicht bleiben. Der Whistleblow-Effekt wäre trotzdem gegeben.
Lumen hat geschrieben:Mit anderen Worten: eine kleine Gruppe, die sich untereinander vertraut trifft die richtigen Entscheidungen für die Schäfchen, die sie beherrscht. Sehr treffend, auch wenn der Autor das wohl so nicht nicht meinte.
Es ist nicht die Aufgabe der Medien Behörden oder Unternehmen bei Cover-Ups zu helfen oder sich nur darum sorgen zu machen.
Ich glaube, dass du da jetzt tatsächlich etwas hineinliest, was die Autoren dieser Artikel nicht gemeint haben. Es geht nicht darum, dass die Medien mithelfen sollen, den eigenen Regierungen die Drecksarbeit zu erleichtern. Das kann aber nicht heißen, dass es erlaubt sein kann, pauschal Geheimhaltung zu brechen, frei nach dem Grundsatz "wer nichts zu verbergen hat, muss sich ja bei der Veröffentlichung keine Sorgen machen", der mit leicht verändertem Wortlaut von Befürwortern des Überwachungsstaates gerne ins Feld geführt wird. Egal wer sich Zugang zu Daten verschafft, die geheim sind - seien es nun die Medien, die in geheimen Staatsaktivitäten schnüffeln oder der Staat, der dasselbe in der Privatsphäre seiner Bürger tut - muss dies begründet tun, will er Legitimation für seine Handlungen haben. Wikileaks, und ganz besonders Assange, treffen diese Unterscheidung allerdings nicht, sondern sehen in der Geheimhaltung prinzipiell etwas Verwerfliches. Diese Sichtweise ist ziemlich totalitär, kompromisslos und vor allem weltfremd. Die SZ hat das heute sehr treffend als invertierte Form von Orwell entlarvt: Totale Öffentlichkeit.
-
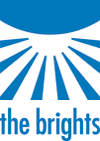
Nanna - Mitglied des Forenteams

- Beiträge: 3338
- Registriert: Mi 8. Jul 2009, 19:06
Re: Einschätzung von Wikileaks
Natürlich wäre ein vernünftiger Mittelweg der Richtige. Das Problem geht aber da weiter: wer entscheidet, was belanglos ist und was nicht? Das mangelnde Vertrauen in die Politik, Wirtschaft und Medien liegt gerade im Gegenteil: es erscheint leider zu oft der Eindruck, dass eine Clique mittels Hinterzimmerpolitik die Entscheidungen trifft und Wahlergebnisse oder sonst etwas ganz egal ist. Die Ziele von Wikileaks zu kritisieren ist auch wieder tendenziell dubios.
Da liegt die Krux. Es geht um Einschätzungen: Wieviel Verschwörung gibt es? Sieht Asange mehr Verschwörung als andere? Womit wird das gemessen? Eine erhebliche Anzahl wird immer wieder bekannt, nur sind Journalisten darauf getrimmt bei jedem neuen Artikel immer wieder die Reset-Taste zu betätigen. Milliarden gehen in Lobbyarbeit, Millionen in Agendasetting, es gibt ein extra Wort für „investigativen Journalismus“ — das doch alles nicht, weil alles immer legit ist. Dann könnten wir ja gerne mehr von Heidi Klum und Co. hören, da ja sonst alles in Butter ist. Sollen Journalisten wie Kurt Kister doch umsatteln und meinetwegen über Adelshäuser berichten. Was für Pfeifen.
SZ hat geschrieben:Je heftiger einer daran glaubt, dass die ganze Welt aus Verschwörungen besteht, desto inbrünstiger muss er, wenn er sich nur genug von den Verschwörern verfolgt sieht, alles, alles enthüllen.
Da liegt die Krux. Es geht um Einschätzungen: Wieviel Verschwörung gibt es? Sieht Asange mehr Verschwörung als andere? Womit wird das gemessen? Eine erhebliche Anzahl wird immer wieder bekannt, nur sind Journalisten darauf getrimmt bei jedem neuen Artikel immer wieder die Reset-Taste zu betätigen. Milliarden gehen in Lobbyarbeit, Millionen in Agendasetting, es gibt ein extra Wort für „investigativen Journalismus“ — das doch alles nicht, weil alles immer legit ist. Dann könnten wir ja gerne mehr von Heidi Klum und Co. hören, da ja sonst alles in Butter ist. Sollen Journalisten wie Kurt Kister doch umsatteln und meinetwegen über Adelshäuser berichten. Was für Pfeifen.
-

Lumen - Beiträge: 1133
- Registriert: Sa 30. Okt 2010, 01:53
Re: Einschätzung von Wikileaks
Ist es jetzt schon soweit, daß Heidi Dir den Schlaf raubt ? 
Grundsätzlich stimme ich Dir auch zu, was die Informationsfreiheit angeht, es kann ja wohl nicht angehen, daß diejenigen über die berichtet wird, erst zustimmen müssen ob über sie berichtet werden darf.
Doch so viel Neues kam bisher nicht rüber, nichts was über Stammtischgetuschel hinausgeht.
Allerdings muß einigen wohl doch die Muffe gehen, wenn man so drastisch reagiert. Seltsam ist es allemal, daß man ihn zeitgleich der Vergewaltigung bezichtigt, bis vor kurzem war das kein Thema. Erinnert mich an Al CApone, den man wegen Steuergeschichten eingebuchtet hat.
Evtl hat er ja noch Sachen in petto die wirklich heiß sind und man will ihn prophylaktisch aus dem Verkehr ziehen.
musicman
Grundsätzlich stimme ich Dir auch zu, was die Informationsfreiheit angeht, es kann ja wohl nicht angehen, daß diejenigen über die berichtet wird, erst zustimmen müssen ob über sie berichtet werden darf.
Doch so viel Neues kam bisher nicht rüber, nichts was über Stammtischgetuschel hinausgeht.
Allerdings muß einigen wohl doch die Muffe gehen, wenn man so drastisch reagiert. Seltsam ist es allemal, daß man ihn zeitgleich der Vergewaltigung bezichtigt, bis vor kurzem war das kein Thema. Erinnert mich an Al CApone, den man wegen Steuergeschichten eingebuchtet hat.
Evtl hat er ja noch Sachen in petto die wirklich heiß sind und man will ihn prophylaktisch aus dem Verkehr ziehen.
musicman
- musicman
- Beiträge: 738
- Registriert: Mi 16. Sep 2009, 21:56
Re: Einschätzung von Wikileaks
Richtig wie so oft im Leben.Lumen hat geschrieben:Natürlich wäre ein vernünftiger Mittelweg der Richtige.
Aber warum redest dann einem narzisstischem Extrem das Wort?
Was belanglos wäre, wäre ja nicht wert veröffentlicht zu werden.Lumen hat geschrieben:Das Problem geht aber da weiter: wer entscheidet, was belanglos ist und was nicht?
Natürlich ist es an sich belanglos, wenn auch der Millionste Mensch erkennt, dass Westerwelle ein wichtigtuerischer, kleiner Dünnbrettbohrer ist, es ist aber nicht belanglos solche "privaten" Einschätzungen von US-Diplomaten zu veröffentlichen. Auch wenn es hinkt wie ein einbeiniger Fisch, auch du willst wohl nicht alles Private von dir Veröffentlicht sehen.
Und? Wird durch Wikileaks daran irgendwas geändert?Lumen hat geschrieben:Das mangelnde Vertrauen in die Politik, Wirtschaft und Medien liegt gerade im Gegenteil: es erscheint leider zu oft der Eindruck, dass eine Clique mittels Hinterzimmerpolitik die Entscheidungen trifft und Wahlergebnisse oder sonst etwas ganz egal ist.
Dies ist doch gnadenloser Unsinn. Es kommt ja wohl auch noch auf das "Wie" und "Warum" drauf an.Lumen hat geschrieben:Die Ziele von Wikileaks zu kritisieren ist auch wieder tendenziell dubios.
Was hat es damit zu tun?Lumen hat geschrieben:Da liegt die Krux. Es geht um Einschätzungen: Wieviel Verschwörung gibt es?
Quasi alles was jetzt als Aufmacher durch die Presse eiert hat weder was mit Verschwörung zu tun, noch ist es grundsätzlich neu.
Vielleicht sieht Herr Assange auch nur noch sich? Wer weiß?Lumen hat geschrieben: Sieht Asange mehr Verschwörung als andere?
Und das wäre?Lumen hat geschrieben: es gibt ein extra Wort für „investigativen Journalismus“
Wie gesagt, es geht um ein gesundes Mittelmaß (nicht um Mittelmäßigkeit!) und auch Menschen deren Horizont nicht über Klum-Schauen hinaus geht, haben eine Lebens- und Informationsberechtigung. Nur muss man es sich nicht ansehen. U.U. - ich weiß es nicht - geschieht aber auch dort die eine oder andere Veröffentlichung (um Zuschauer anzulocken/zu halten) die eigentlich nicht getätigt werden sollte.Lumen hat geschrieben: Dann könnten wir ja gerne mehr von Heidi Klum und Co. hören, da ja sonst alles in Butter ist.
Ja, mit subjektiv steigender Tendenz.Lumen hat geschrieben:Was für Pfeifen.
Aber noch weniger Hirn und Verstand ist besser?
-

1von6,5Milliarden - Mitglied des Forenteams

- Beiträge: 5236
- Registriert: Sa 25. Nov 2006, 15:47
- Wohnort: Paranoia
Re: Einschätzung von Wikileaks
Erstmal ist es ein (gewaltiger) Unterschied ob Leute auf der Straße eine Ahnung haben, oder ob etwas offiziell festgehalten ist. Die Presse hingegen zeichnete stets ein abgemildertes, beschönigtes Bild von gewissen Politikern. Sicher kam schon durch, dass Westerwelle kein Genscher ist.
Wäre sonst herausgekommen, das US-Diplomaten sich als Spione betätigen (UN, Maulwürfe in Koalitionsverhandlungen) — jede Wette — da wäre der Teufel los gewesen. Das wäre mit Sicherheit die Titelstory im Spiegel und Co geworden.
Stattdessen wird Druck auf Wikileaks aufgebaut und Stimmung auf der Straße durch „Einschätzungen“ beeinflusst. Wenn man Informationen direkt nicht angehen kann, dann versucht man eben die Quelle der Information schlecht dastehen zu lassen. Das klappt noch in jedem billigen US-Gerichtsfilm. Das ist mehrfach effektiv: 1) Exempel statuieren: diese Handlung wird nicht toleriert, es gibt Shitstorm und Ächtung. Selbst wenn es glimpflich ausgeht, es wird die Hürde hoch gesetzt. 2) Ein Projekt wie Wikileaks hängt von Spenden und Helfern ab, hier eingreifen um das Projekt zu stören.
Schaut man sich das Propagandamodell an, dann erkennt man schon einige Elemente wieder. Manche Punkte lassen sich nicht anwenden, weil Wikileaks keine „normale“ Zeitung / News Media ist. Hier die fünf Punkte allgemein:
Erstaunlich wie das immer wieder funktioniert.
Wäre sonst herausgekommen, das US-Diplomaten sich als Spione betätigen (UN, Maulwürfe in Koalitionsverhandlungen) — jede Wette — da wäre der Teufel los gewesen. Das wäre mit Sicherheit die Titelstory im Spiegel und Co geworden.
Stattdessen wird Druck auf Wikileaks aufgebaut und Stimmung auf der Straße durch „Einschätzungen“ beeinflusst. Wenn man Informationen direkt nicht angehen kann, dann versucht man eben die Quelle der Information schlecht dastehen zu lassen. Das klappt noch in jedem billigen US-Gerichtsfilm. Das ist mehrfach effektiv: 1) Exempel statuieren: diese Handlung wird nicht toleriert, es gibt Shitstorm und Ächtung. Selbst wenn es glimpflich ausgeht, es wird die Hürde hoch gesetzt. 2) Ein Projekt wie Wikileaks hängt von Spenden und Helfern ab, hier eingreifen um das Projekt zu stören.
Schaut man sich das Propagandamodell an, dann erkennt man schon einige Elemente wieder. Manche Punkte lassen sich nicht anwenden, weil Wikileaks keine „normale“ Zeitung / News Media ist. Hier die fünf Punkte allgemein:
- Ownership: Verlage sind im Besitz größerer Unternehmen, dadurch unterliegen die Nachrichten bereits einer gewissen Interessenlage. Passt auf die Situation, denn Wikileaks publiziert bestimmte Informationen, andere wiederum quälen sich damit (und gehen dagegen an). Das ist eine erwartbare Reaktion.
- Funding: Medien werden zumeist von Werbung finanziert. Kritische Medien kommen dabei tendenziell schlechter weg, weil Firmen tendenziell weniger inserieren als in ihnen wohlgesonnene Blätter. Hier wirkt auch Flak (siehe unten). Indem vor Wikileaks gewarnt wird, wird der Support (Spenden etc) untergraben.
- Sourcing: für Journalisten sind bestimmte Quellen stets leichter verfügbar und es besteht außerdem eine Abhängigkeit. Kritische Journalisten bekommen weniger Termine, weniger Zugang usw. Entfällt im Falle von Wikileaks. Agenda-Setting greift hier zum Beispiel ein, um bereits vorgekaute Informationen bereitzustellen, die genehm ist.
- Flak: negative Reaktionen auf Meldungen. Organisationen bilden regelmäßig "Flak Machines" um negativer Presse entgegenzuarbeiten. Das erfolgt seit geraumer Zeit über Agenturen, die Leserbriefe schreiben, wütende Telefonanrufe tätigen, gefakte Straßenumfragen. Wikipedia schreibt dazu: „to discredit organizations or individuals who disagree with or cast doubt on the prevailing assumptions which Chomsky and Herman view as favorable to established power (e.g., "The Establishment"). Unlike the first three "filtering" mechanisms — which are derived from analysis of market mechanisms — flak is characterized by concerted and intentional efforts to manage public information“
- Anti-Ideology: „Anti-ideologies exploit public fear and hatred of groups that pose a potential threat, either real, exaggerated, or imagined.“. Im vorliegenden Fall liegt der „Anarchist“ Ansagne auf dem Silber leuchtenden Präsentierteller. Gerade wenn dann auch noch Orwell bemüht wird, ist es überdeutlich.
Erstaunlich wie das immer wieder funktioniert.
-

Lumen - Beiträge: 1133
- Registriert: Sa 30. Okt 2010, 01:53
Re: Einschätzung von Wikileaks
Lumen hat geschrieben:Natürlich wäre ein vernünftiger Mittelweg der Richtige. Das Problem geht aber da weiter: wer entscheidet, was belanglos ist und was nicht? Das mangelnde Vertrauen in die Politik, Wirtschaft und Medien liegt gerade im Gegenteil: es erscheint leider zu oft der Eindruck, dass eine Clique mittels Hinterzimmerpolitik die Entscheidungen trifft und Wahlergebnisse oder sonst etwas ganz egal ist.
Nun, ich denke, dass du nicht umhin kommen wirst, einzugestehen, dass wir beispielsweise bei internen Papieren des BND oder des Verfassungsschutz keine Volksabstimmung darüber ansetzen können, ob deren Inhalte belanglos sind oder nicht. Kontrolle kann hier nur indirekt erfolgen, indem parlamentarische Kontrollausschüsse mit a) entsprechender Macht ausgestattet werden und b) mit aufrechten Demokraten besetzt werden. Zumindest zweiteres ist in einer repräsentativen Demokratie direkt in der Hand des Wählers. Wenn der Wähler keine ihm genehmen Parteien oder Personen wählen kann, steht es ihm übrigens frei, selbst zu kandidieren (das ist immer das, was ich so belustigend finde: Es wollen alle mitreden, nur Arbeit will möglichst keiner damit haben: alle beschweren sich, dass sie nur alle vier Jahre ein Kreuzchen machen dürfen, aber im Grunde will auch keiner mehr, als maximal einmal im Jahr eines machen - sorry Leute, so kommen wir nicht weiter).
Du hast, um beim Thema zu bleiben, auch impliziert, dass es kleine Gruppen sind, die Macht haben und sich nicht um den Wählerwillen kümmern. Verzeihung, aber ein bisschen Realitätsferne klingt da schon durch, finde ich. Es gibt da nämlich eine lange Reihe von Problemen und Implikationen:
- Der Wählerwille ist selten klar erkennbar.
- Der Abgeordnete ist verfassungsrechtlich seinem Gewissen verpflichtet, aus Sicht der Volkes dem Wählerwillen und aus Sicht der Partei der Fraktionsdisziplin unterworfen. Es gibt ganze Bibliotheken politikwissenschaftlicher Literatur über dieses Problem und trotzdem keine allgemeine Lösung dafür außer der, dass der Parlamentarier meist recht flexibel sein muss, was ihm dann in der Öffentlichkeit aber schnell vorgeworfen wird.
- In einer pluralistischen Gesellschaft fühlt sich immer einer zurückgesetzt und führt dann meist "Volkes Stimme" an, das eigentlich etwas ganz anderes wolle, selbst wenn der Sprecher ein eingefleischter Vertreter einer Minderheitengruppe ist (ich finde das allerdings nicht per se verwerflich, so funktioniert nunmal - auch - öffentliche Meinungsbildung).
- Sachzwangpolitik ist langweilig, ermüdend und tendentiell auch demokratiegefährdend, aber oftmals kommt man aufgrund leerer Kassen, internationalen Drucks oder verfassungsrechtlicher Vorgaben nicht darum herum.
- Demokratische Politik ist immer ein Austarieren vieler unterschiedlicher Interessen. "Hinterzimmerpolitik", obwohl problematisch wegen ihrer Neigung zum Korporatismus, ist manchmal ein deutlich effizienteres Mittel zur Entschlussfindung, weil offener gesprochen und in einem kleinen Personenkreis verhandelt werden kann. So wichtig Kontrolle durch die Bevölkerung ist, aber demokratische Prozesse sind auch umso ineffizienter und langwieriger, je basisdemokratischer sie organisiert sind. Von daher muss es manchmal auch die Möglichkeit geben, im Tagesgeschäft oder bei sensiblen internationalen Verhandlungen den "kurzen Dienstweg" einzuschlagen.
Steigen wir noch etwas tiefer in das Problemfeld politischer Entscheidungsfindung ein (hab dazu mal eine Seminararbeit geschrieben, aus der ich kurz etwas ausbreiten werde): Entscheidungen werden in der Politik oftmals in einem Umfeld von "ambiguity" (Mehrdeutigkeit) gefällt (zugrunde liegen die Erkenntnisse der Modelle "multiple streams" und "garbage can model of choice"):
- Das zu lösende Problem ist nicht klar erkannt, seine Definition ist vage und verschiebt sich laufend;
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Problem anzugehen;
- Der Begriff meint nicht Unsicherheit (uncertainty);
- Mehr Information reduziert die Mehrdeutigkeit nicht (hier muss ich instinktiv an den Wikileaks-Glauben denken, dass mehr Information an sich schon Übersichtlichkeit schafft und daraus effektive und effiziente Kontrolle resultiert);
- Die Partizipation in den entsprechenden Organisationen fluktuiert stark;
- Entscheidungsträger wissen oft nicht genau, was sie wollen (bzw. wollen sollten = Wählerwille);
- Unklare Verhaltensweisen (technology): Den Individuen ist ihr Platz / ihre Funktion im Gesamtsystem nicht bekannt; sie wissen gar nicht genau, welche Ergebnisse (outcome) ihre Handlungen nach sich ziehen werden;
- So gut wie immer besteht Zeitdruck, dadurch sinkt die Zahl der zu prüfenden Alternativen rapide;
- Die überall vorkommende Mehrdeutigkeit in der Politik macht Manipulation zu ihrer Kontrolle notwendig (im Sinne von unabdingbar). Dies gilt unabhängig von der ethischen Lauterkeit der betreffenden Akteure und fußt im klassischen Problem jeder Zielbestimmung, nämlich dem, dass es für normative Fragen keine Letztbegründung gibt, die mit eindeutigen wissenschaftlichen Mitteln zu finden ist; Was "gut" ist und was "sein soll" ist Gegenstand von Diskurs (siehe auch: Diskurstheorie, Naturalistischer Fehlschluss). Im Rahmen dieses Diskurses ist es notwendig, die Mehrdeutigkeit zu reduzieren, um eindeutige Aussagen treffen zu können und das heißt zwangsläufig, dass Information, die nicht zusammenpasst, manipuliert werden muss, so dass sie es tut. Dahinter steht meist keine böse Absicht und auch Menschen mit bestem Willen sind gezwungen (!) diese Manipulation von Information vorzunehmen. Ich sage das deshalb so ausführlich, weil ich möchte, dass verstanden wird, dass in diesem Zusammenhang Manipulation von Information nichts Verwerfliches oder Böswilliges darstellt, sondern eine systemimmanente Voraussetzung für die Entscheidungsfindung ist und zwar unabhängig davon, wie das zugrundeliegende System im Detail organisiert ist. Behörden in Nordkorea stehen hier prinzipiell vor demselben Problem wie in Deutschland, den USA oder wie Wikileaks als Organisation.
Kurz zusammengefasst: Man muss unter den Bedingungen von Zeitdruck und Mehrdeutigkeit die Einigung auf eine bestimmte Sicht der Dinge forcieren (=Manipulation), um überhaupt Prämissen für eine Entscheidungsfindung zu haben, denen alle Beteiligten folgen können. - Information als zentraler Bestandteil von Manipulation ist nie wertneutral. Die Existenz objektiver Information wird in diesem Modell aus prinzipiellen Gründen verneint: Information muss immer interpretiert werden. So gesehen kann Wikileaks nie völlig objektiv arbeiten (allerdings natürlich objektiver als andere in dem Sinne, dass es kritizistisch arbeitet und Uneigennützigkeit anstrebt).
- Politische Manipulation versucht in erster Linie Bedeutung (meaning), Klarheit (clarification) und Identität (identity) zu erzeugen. Es geht also ersteinmal darum zu bestimmen "Wer sind wir?", "Was wollen wir?", "Wer sind unsere potentiellen Verbündeten/Gegner?" usw., auch wenn z.B. Gruppenbildungen erstmal willkürlich sind (beispielweise wenn motivierte türkischstämmige Facharbeiter mit gebrochen Deutsch sprechenden Einwanderern zu einem Feindbild vermischt werden).
- Die Manipulation geschieht nicht notwendigerweise bewusst, die Manipulatoren sind oft genauso Opfer ihrer eigenen Vereinfachungen wie die Normalbürger.
Die Manipulation von Information und politischer Meinung ist nicht von grundauf "böse". Sie ist in einer pluralistischen Welt auch (nicht nur!) etwas völlig normales. Systemanalytisch gesehen ist sie sogar notwendig, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können, weil man sich andernfalls totdiskutiert und die Entscheidung blockiert ist - das ist bei zeitkritischen Entscheidungen nicht hinnehmbar (bestes Beispiel: Klimawandel. Das Handeln ist hier, selbst wenn die öffentliche Meinung dazu massiv manipuliert werden muss, höchstwahrscheinlich in jedem Fall verantwortlicher als die Untätigkeit).
Der Glaube, dass absolute Transparenz hieran etwas ändern würde, ist bestenfalls als niedlich zu bezeichnen. Hätten wir die totale Verfügbarkeit von Staatspapieren, den gläsernen Staatsapparat (in dem der Bürger dem Staatsapparat so umfassend misstraut, wie der Staat dem Bürger bei Orwell), dann würde sich das Problem nur verlagern, etwa auf die Straße:
Die Sarrazindebatte zeigt, wie politische Manipulation im Grunde durch eine einzige Person forciert werden kann, die noch dazu ihren Gedankengang größtenteils offenlegt. Sarrazin hat es geschafft, dass Millionen von Bürgern seinem Weltbild folgen und das ganz ohne großangelegte, perfide Medienkampagne. Teile von Sarrazins Ideen sind im besten Fall hölflich als "stark verkürzte Version der Wirklichkeit" zu bezeichnen, jedoch hat die totale Öffentlichkeit dieser Diskussion nicht dazu beigetragen, dass das Verwerfliche (etwa die zwischen den Zeilen schwelende Fremdenfeindlichkeit) aus der Debatte verschwunden wäre. In der Schweiz hat vor kurzem in totaler Öffentlichkeit das Volk (!) über eine menschenunwürdige Politik entschieden. Die Manipulation der Wirklichkeit, die ja nur allzuoft eine Selbstlüge ist, bleibt also vorhanden, selbst wenn statt Hinterzimmerpolitik öffentlichste Basisdemokratie herrscht.
Bin ich also für mehr Hinterzimmerpolitik? Nein, definitiv nicht. Bin ich gegen Whistleblowing? Nein, definitiv auch nicht.
Aber ich bin der Meinung, dass nur ein effektives, durchdachtes System von checks and balances uns davor bewahrt, böswilligen ("Verschwörung") oder unbegründeten ("Schwachsinn") Manipulationen der Wirklichkeit aufzusitzen, wir uns also Weltbilder anzueignen könnten, die unsere plurale und friedliche Lebensweise bedrohen. Was uns bei diesem Ziel nicht weiterbringt, ist die pauschale und undurchdachte Veröffentlichung allen Geheimmaterials, das Wikileaks in die Finger bekommt. Allerdings könnte Wikileaks in einem veränderten Rahmen eine äußerst wichtige Rolle spielen, das hat Daniel Domscheit-Berg kürzlich auch in diesem Artikel skizziert.
Ich bin weiterhin der Meinung, dass es nirgendwo ohne ein gewisses Restvertrauen gehen wird, schon allein, weil dies eine Grundressoure sozialen Miteinanders ist und totale Kontrolle eben vor allem eines ist: total(itär). Dies gilt ja auch für Organisationen wie Wikileaks. Wenn man es sich recht überlegt, ist der deutsche Bundestag tausendmal öffentlicher als diese Internetguerilla, aus deren eigenen Reihen von diktatorischem Führungsstil berichtet wird. Trotzdem vertrauen viele Wikileaks, weil sie lautere Absichten und integere Persönlichkeiten dahinter vermuten. Bei aller Kritik an Wikileaks halte ich es trotzdem für nötig, dass dieses Vertrauen weiterhin möglich sein muss und nötig ist, sowohl privaten wie staatlichen Organisationen gegenüber. Es wäre der goldene Mittelweg, von dem am Anfang die Rede war.
Lumen hat geschrieben:Da liegt die Krux. Es geht um Einschätzungen: Wieviel Verschwörung gibt es? Sieht Asange mehr Verschwörung als andere? Womit wird das gemessen?
Wie vielleicht zu erkennen ist, habe ich mich mit solchen Fragen schon (dank Studium) ein wenig eingehender beschäftigt. Meine persönliche Einschätzung ist: Es ist insgesamt gar nicht so viel, was es an organisierter Verschwörung gibt. Vieles ist einfach nicht-gesteuerten internen Prozessen in Behörden und Konzernen und sozialen Dynamiken zu verdanken, auf die einzelne Verschwörer überhaupt keinen Einfluss haben. Deshalb ist auch mein Pessimissmus so hoch, dass Veröffentlichung prinzipiell schon etwas besser macht, weil die Öffentlichkeit genau denselben Dynamiken unterliegt, die auch innerhalb von Organisationen zu unethischen Entwicklungen führen. So ändern beispielsweise regelmäßige Aktionen von Tierschützern und kritische Zeitungsberichte seit Jahren kaum etwas daran, dass Tiere in brutaler Massentierhaltung gehalten werden. Bei der Flutkatastrophe in Pakistan kamen kaum Spenden zusammen, obwohl alles in völliger Öffentlichkeit stattfand. Bei den Tieren fehlt die direkte Betroffenheit und bei den Pakistanis war der Schockeffekt der Bilder nicht groß genug - übigens ein Schicksal, das Wikileaks auf lange Sicht auch ereilen könnte, wenn alle sich so sehr an Enthüllungen gewöhnt haben, dass denen im einzelnen kaum mehr Beachtung geschenkt ist, weil man sich an den Sumpf gewöhnt hat.
Interessanterweise hat Wikileaks selbst dazu beigetragen, einige Verschwörungstheorien zu Fall zu bringen, etwa in der Türkei, wo man lange daran glaubte, dass die USA insgeheim die Kurden unterstützen. Meist stellt sich eben heraus, dass es gerade die reißerischen Stories sind, die rundherum erfunden sind, wohingegen die kleinen Alltagsverschwörungen wie massenhafte Misshandlungen in der Familie auch hierzulande und in den "besten Familien" totgeschwiegen und bagatellisiert werden. Das "Böse" soll am besten weit weg sein, sowohl geographisch als auch sozial (HartzIV-Schmarotzer, korrupte Manager, pädophile Priester, chinesische Geheimdienstler und arabische Terroristen als namentliche Beispiele).
In dem Artikel von Daniel Domscheit-Berg (s.o.) ist anfangs die Rede von einer Pflegerin, die skandalöse Zustände in ihrem Altenheim aufdecken wollte und dafür vom Chef gemobbt wurde. Solche kleinen Alltagsverschwörungen sind vermutlich viel eher das, was es tatsächlich massenhaft gibt, aber daran sind nicht korrupte Politiker schuld, sondern banale Reihenhausbewohner, die sich äußerlich sofort mit dir solidarisieren würden, wenn gegen "die da oben" gehetzt wird. Hannah Arendt hat dafür den treffenden Ausdruck der "Banalität des Bösen" geprägt. Hier fehlt es vielleicht tatsächlich an einer unabhängigen, spendenbasierten Zwischenstelle zwischen Medien und Whistleblowern, eine, die weder in die von dir sehr schön dargelegten Interessenkonflikte der Medien verwickelt sind, noch staatlicher Kontrolle ihrer Inhalte unterliegen (was die Idee ja konterkarieren würde) und trotzdem konstruktiv arbeitet - also nicht Teegespräche von Diplomaten veröffentlicht.
Der Grund, weshalb ich weiter oben in diesen Stichpunktlisten so textreich auf den schmutzigen und chaotischen Alltag der politischen Entscheidungsfindung eingegangen bin, ist auch der, dass ich das Bild vom übermächtigen Zirkel aus Verschwörern in jedem Partei- und Konzernvorstand gerne brechen möchte. Mein Fokus liegt da eher auf sozialen Prozessen, die zu üblen Ergebnissen führen und weniger auf einem verdrehten Geschichtsbild von wegen "große Männer bzw. große Verschwörer schreiben Geschichte". Verschwörungstheoretiker werden da schnell quasireligiös: Die Verschwörer sehen alles, wissen alles, haben das ganze sozialtechnische Wissen, um Millionen von Menschen gezielt zu beeinflussen, verfolgen einen ("göttlichen") Plan und können nur durch umfassende Reinigungsmaßnahmen und einen Umbau der Gesellschaft zu Fall gebracht werden - hoppla, kennen wir das Muster nicht irgendwoher?
Ich möchte zum Abschluss eines langen und vielleicht nicht durchgehend geradlinigen Beitrags gerne nochmal auf den Artikel von Domscheit-Berg verweisen, denn skizziert, wie eine verantwortliche Whistleblower-Organisation vielleicht aussehen könnte.
-
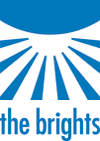
Nanna - Mitglied des Forenteams

- Beiträge: 3338
- Registriert: Mi 8. Jul 2009, 19:06
Re: Einschätzung von Wikileaks
Nanna hat geschrieben:Lumen hat geschrieben:Natürlich wäre ein vernünftiger Mittelweg der Richtige. Das Problem geht aber da weiter: wer entscheidet, was belanglos ist und was nicht? Das mangelnde Vertrauen in die Politik, Wirtschaft und Medien liegt gerade im Gegenteil: es erscheint leider zu oft der Eindruck, dass eine Clique mittels Hinterzimmerpolitik die Entscheidungen trifft und Wahlergebnisse oder sonst etwas ganz egal ist.
Nun, ich denke, dass du nicht umhin kommen wirst, einzugestehen, dass wir beispielsweise bei internen Papieren des BND oder des Verfassungsschutz keine Volksabstimmung darüber ansetzen können, ob deren Inhalte belanglos sind oder nicht.
Das interessante an Veröffentlichungen dieser Art ist weniger der Inhalt, als die Tatsache, dass sie überhaupt öffentlich werden können. Ein Journalist muss alles bringen dürfen, was ihm in die Hände fällt. Wenn Staatsorgane Staatsgeheimnisse durchsickern lassen, dann sind diese Behörden das Sicherheitsrisiko und nicht der Journalist, der die Undichtheit aufdeckt.
-

ujmp - Beiträge: 3108
- Registriert: So 5. Apr 2009, 19:27
80 Beiträge
• Seite 1 von 4 • 1, 2, 3, 4
Zurück zu Gesellschaft & Politik
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste