Sisyphos hat geschrieben:Was "gut" ist und was "böse", ist immer abhängig vom Standpunkt. In der Regel gelten immer die anderen als "böse", während man sich selbst als "gut" hinstellt. Man kann das in allen kriegerischen Auseinandersetzungen beobachten. Es gibt also nicht "das Gute" und "das Böse", sondern nur Menschen und Gruppen von Menschen mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Lernerfahrungen in unterschiedlichen historischen und sozialen Kontexten.
Freilich kann man sich intersubjektiv darüber einigen, was als wertvoll zu erachten ist (z.B. die Einhaltung der Menschenrechte) oder was es unter allen Umständen zu vermeiden gilt (z.B. die Folter). Aber selbst dabei wird keine gemeinsame, von allen Menschen getragene Definition dessen entstehen, was als "gut" oder als "böse" gelten kann. Die globalen Kontroversen um die genannten Beispiele verdeutlichen das sehr schön.
Das klingt sehr subjetktivistisch. So kenne ich dich gar nicht.
Gewöhnlich werden die Worte "gut" und "böse" in einem absoluten, transzendentalen, metaphysiscen Sinn verwendet. Man glaubt an irgendwelche kosmischen, göttlichen Prinzipien. Wichtig hierbei ist, dass diese Prinzipien nicht Fiktion oder subjektiv oder intersubjektiv sind, sondern einen ontischen Status haben. Daher kann man behaupten, dass all das, was von dem Prinzip des Guten abweicht böse ist; man hat es nicht mehr nötig zu diskutieren. Ethische Regeln sind nach dieser Auffassung nicht hypothetisch, sondern kognitiv. Sie sind lediglich Darstellungen etwas Absoluten, unbzweifelbar wahren.
Im Gegenatz zu den meisten übrigen ethischen Auffassungen wie beispielsweise dem Utilitarismus ist dieses System widerlegbar es kann wahr oder falsch sein. Denn es beschreibt Existenzen oder Vorgänge in der Wirklichkeit. Entspricht das, was dieses absolutistische System aussagt, der Wirklichkeit, ist das System mitsamt allen inhärenten Normen und Werten wahr. Entspricht es allerdings nicht der Wirklichkeit, ist es falsch. Die Normen und Werte dieses Systems sind zwingend an ontologische Vorraussetzungen gebunden. Man kann daher das System als Ganzes falsifizieren, indem man aufzeigt, dass die Ontologie unwahr ist. Dies entspricht dem Kongruenz-Postulat von Hans Albert.
Diese Prinzipien muss man nicht notwendigerweise widerlegen; es genügt, die mangelnde Begründung aufzuzeigen. Derjenige, der die Existenz von etwas behauptet, steht in der Beweispflicht. Er muss stichthaltige Gründe liefern, warum seine kognitiven Hypothesen wahr sind; gelingt ihm dies nicht, hat man allen Grund, sie zu verneinen. Daher erübrigt es sich eigentlich, aufzuzeigen, dass nirgends in diesem Universum irgendein numinoses Reich der Werte existert. Aber man kann ein solches Werterech auch widerlegen. Will man einen ernsthaften und überzeugenden Standpunkt beziehen und vertreten, ist es daher sinnvoll, sich mit solchen Gegenargumenten zu beschäftigen und sie in den Diskurs einzubringen.
Gegen Werteontologien gibt es meiner Erachtens drei Hauptargumente:
Es ist nicht möglich, dass sich solch ein reich der Werte entiwckelt haben könnte. Wie soll so ein Wertereich bitte entstanden sein? Auch wirft die Einführung eines solchen Reiches schwere Fragen auf. Wie sollchen wir dieses Reich wahrnehmen können? Wie soll irgendeine Wechselwirkung standfinden?
Die moderne Hirnforschung zeigt uns, wie wir Moral in unserem Kopf erfinden. Es handelt sich bei Normen und Werten um Verdrahtungen und Zustände in unserem Gehirn. Mehr steckt nicht dahinter. Es ist ein vollkommen natürlicher Vorgang, wenn wir moralisch Urteilen oder über ethische Werte nachdenken. Dieser natürliche Vorgang lässt sich auch vollständig auf die neurobiologischen Grundlagen zurückführen. In ferner Zukunft werden wir anhand eines bestimmten Gehirnzustandes, auf eine moralische Empfindung schließen können. Genauso werden wir dazu in der Lage sein, unsere Attitüden und unser Verhalten anhand unseres Gehirns zu erklären.
Das dritte Argument ist wohl ein vituoser Zirkel. Wir leben in einem einheitlich-zusammenhängenden Universum. Alles in der Natur besteht aus einem einzigen Stoff: Materie. Jede hohe Seiensform ist nichts weiter als eine emergentische Eigenschaft des Stoffes, der auf der ontologischen Entwicklungshirarchie darunter liegt. Alles in diesem Universum hat sich in einer einzigen kosmischen Evolution entwickelt. Außerhalb dieser Natur ist nichts.
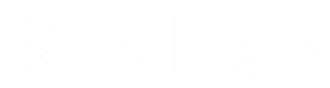
 Ich will mich aber hier keineswegs zu einem Verfechter dieser Lösung aufschwingen.
Ich will mich aber hier keineswegs zu einem Verfechter dieser Lösung aufschwingen.